Praxis für Neurologie
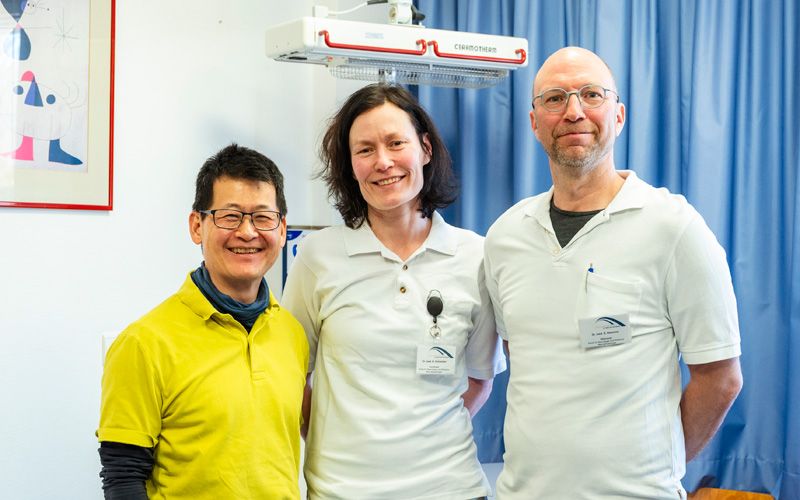
Team:
Hinweis zu Terminen
Bitte vereinbaren Sie frühzeitig einen Termin.
Unsere momentanen Wartezeiten: Sprechstunde: 6 Monate und Doppleruntersuchung: 8 Monate
Bitte nutzen Sie für Terminanfragen bevorzugt unsere E-Mail-Adresse.
Leistungsspektrum
In der Praxis für Neurologie wird das gesamte Spektrum der neurologischen Erkrankungen behandelt. Besondere Schwerpunkte der neurologischen Erkrankungen wie Multiple Sklerose oder Borreliose, anfallsartige Erkrankungen wie Epilepsie oder Schlaganfall, Bewegungsstörungen wie Parkinson oder Restless-Legs-Syndrom und Kopfschmerzen wie Migräne oder Spannungskopfschmerzen. Darüber hinaus, werden dementielle Störungen, periphere Nervenläsionen, Schwindel, Gefäßerkrankungen des Gehirns sowie Bandscheibenvorfälle behandelt. Dabei ist uns ein vertrauensvoller Kontakt zu den Patienten wichtig. Wir legen Wert auf eine enge Kooperation mit den anderen Fachbereichen in den Gesundheitszentren. Eine Zusammenarbeit mit der Klinik für Neurologie des Sophien- und Hufeland Klinikums besteht, so dass erforderliche stationäre Untersuchungen unkompliziert gebahnt werden können.
Die neurologische Untersuchung umfasst neben einer Anamnese die körperliche Untersuchung. Hierbei werden Hirnnerven, Kraft (Motorik), Sensibilität und Koordination geprüft. Infolge der anamnestischen und klinischen Befunde werden die diagnostischen Verfahren vereinbart. Bei Erstvorstellung wäre es sehr hilfreich, wenn Sie sämtliche medizinische Unterlagen (z.B. stationäre oder ambulante Berichte, Untersuchungsbefunde) mitbringen. Alle Untersuchungsbefunde werden im Abschlussbericht an die/den zuweisende/n Kollegin/Kollegen zusammengefasst.
Diagnostische Verfahren
- Elektroneurographie (ENG) – elektrische Messung der Nervenleitfähigkeit an den Armen und Beinen mit Oberflächen- und Nadelelektroden. Eine gesundheitliche Gefährdung liegt nicht vor, insbesondere bestehen keine Kontraindikationen für Schrittmacherimplantate.
- Elektroenzephalographie (EEG) – elektrische Spannungen des Gehirns werden mittels Elektroden registriert, verstärkt und visualisiert. So können lokale Funktionsstörungen oder epilepsietypische Potenziale (ETPs) nachgewiesen werden. Aus diagnostischer Sicht ist es wünschenswert, wenn Sie während der Untersuchung einschlafen.
- Evozierte Potenziale (AEP, SEP, VEP) – durch akustische, elektrische oder visuelle Reize wird die Funktion der jeweiligen Nervenbahnen (Hör-, sensible und Sehnbahnen) überprüft. So können Läsionen entlang des Bahnverlaufes nachgewiesen werden.
- Doppler-Duplexsonographie der hirnzuführenden Gefäße – mit Hilfe von Ultraschallwellen können strukturelle Veränderungen der Gefäße (Atherosklerose) und Verengungen (Stenosen) dargestellt werden. Der Schweregrad der Verengung ist anhand der Bestimmung von Flussgeschwindigkeiten möglich.
- Hirnleistungstests und Riech- sowie Geschmackstest – die standardisierten Fragebögen dienen der Diagnostik von Gedächtnis- und Konzentrationsstörungen. Sie stellen einen wesentlichen Bestandteil in der Demenzdiagnostik dar. Ein Richttest kann in der Frühphase einer Parkinson’schen Erkrankung richtungsweisend sein.
- Laboruntersuchungen – die Blutproben werden im Wesentlichen im Sophien- und Hufeland-Klinikum untersucht. Neben den routinemäßigen Untersuchungen werden auch spezielle Untersuchungen wie Medikamentenkonzentrationen durchgeführt.
- Schellong-Test – Blutdruck und Puls werden im Liegen und Stehen gemessen und im Verhältnis zueinander interpretiert. So können Aussagen über orthostatische Dysregulation getroffen werden, beispielsweise in der Schwindel- oder Synkopendiagnostik
